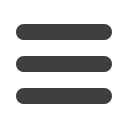
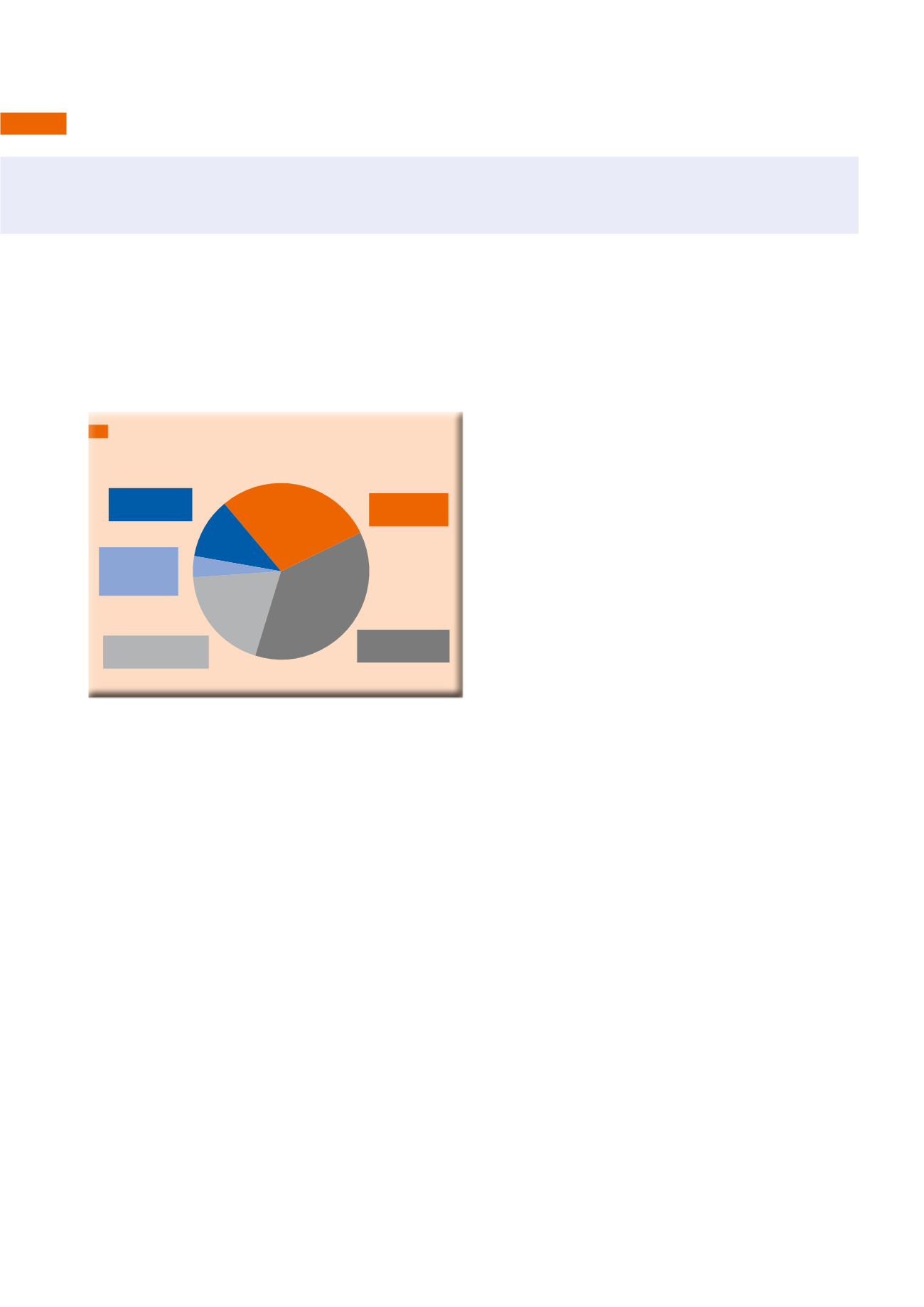
12
VR
MEDICUS
Praxis.
Längst hat der Digitalisierungsprozess das Gesundheitswe-
sen erreicht. Patienten und Gesundheitsinteressierte haben
über das (mobile) Internet Zugriff auf eine Fülle von Informa-
tionen, Online-Terminvereinbarungssysteme und Portale zur
Krankenhaus- und Arztsuche sowie -bewertung. Fast täglich
kommen neue Gesundheits-Apps – teilweise in Verbindung
mit sogenannten Wearables – auf den Markt.
Als die erste deutschsprachige Onlinepraxis DrEd im Jahr 2011 ihre „Pforten“ öffnete, war der Aufschrei groß.
Angesichts einer großzügigeren Auslegung des „Fernbehandlungsverbots“ wagen sich mittlerweile auch die
ersten Krankenkassen in den Bereich der virtuellen Sprechstunde vor.
45% der Bundesbürger diese Vorteile erkannt und würden öf-
ter beziehungsweise gelegentlich Online- oder Videosprech-
stunden nutzen. Weitere 19% haben hierzu noch keine feste
Meinung und 17% stehen der virtuellen Sprechstunde (eher)
ablehnend gegenüber (vgl. Abb.). Diese Ergebnisse werden
durch die ebenfalls Ende 2015 lancierte Umfrage des For-
sa-Instituts im Auftrag der Gothaer Versicherung unter 1.000
Teilnehmern bestätigt: 47% der Deutschen wären bei einem
entsprechenden Angebot bereit, ihren Arzt bei Fragen zur
Gesundheit oder bei leichten Beschwerden per Videotelefo-
nie zu konsultieren.
Auch für Ärzte können sich neue Optionen bieten. So besteht
die Möglichkeit, den Online-Terminservice auch von zu Hause
aus und ohne medizinische Fachangestellte als spezielles An-
gebot außerhalb der normalen Sprechzeiten (z. B. für Berufs-
tätige abends oder an Wochenenden) zu organisieren und
so die Auslastung der Praxis zu verbessern. Experten halten
dabei die virtuelle Sprechstunde insbesondere für Rückfra-
gen, Befundbesprechungen und Beratungen sowie im Zu-
sammenhang mit der Betreuung chronisch kranker Patienten
für geeignet.
In anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, ist die vir-
tuelle Sprechstunde längst etabliert. Die Schweizer können
seit dem Jahr 2000 auf das Telemedizinportal MedGate zu-
greifen, über das bis dato mehr als fünf Millionen Patienten-
kontakte liefen. In Deutschland stehen einer solchen Entwick-
lung jedoch noch einige Hindernisse im Weg, unter anderem
fehlende Vergütungslösungen. Ferner verbietet die ärztliche
Berufsordnung eine ausschließliche Fernbehandlung, da von
einer Diagnosestellung und Therapie ohne direkten persön-
lichen Arzt-Patienten-Kontakt auch Gefahren wie etwa Fehl-
diagnosen ausgehen können.
Dennoch zeigt sich auch hierzulande, dass sich der Trend
zur Telemedizin nicht aufhalten lässt. Während in der Ver-
gangenheit pauschal und ausdrücklich vom sogenann-
ten Fernbehandlungsverbot die Rede war, weist nun die
Bundesärztekammer (BÄK) darauf hin, dass das Berufsrecht
Fernbehandlungen unter bestimmten Voraussetzungen er-
laubt (vgl.
http://bit.ly/1RFPtpY). Grund ist, dass die Berufsord-
nung in Ermangelung einer Legaldefinition des Fernbehand-
lungsbegriffs einen gewissen Auslegungsspielraum eröffnet.
Wann fällt das Fernbehandlungsverbot?
Auch in der Telemedizin und Telematik gibt es Fortschritte,
wenngleich hier der Gesetzgeber mit dem im vergangenen
Jahr beschlossenen E-Health-Gesetz (vgl. Artikel Seite 4) hin-
ter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Angesichts der
vielfältigen Möglichkeiten im E-Health-Bereich ist das Ange-
bot ärztlicher Sprechstunden via Online-Videokonferenz eine
logische Fortsetzung des Digitalisierungsprozesses. Die Idee
bietet nicht nur im Hinblick auf die Sicherstellung der Versor-
gung vor dem Hintergrund des Ärztemangels viele Vorteile:
Patienten ersparen sich den Weg in die Praxis. Die Parkplatz-
suche sowie Wartezeiten vor Ort entfallen ebenso wie die po-
tenzielle Ansteckungsgefahr im Wartezimmer. Insbesondere
für Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder in unterver-
sorgten Gebieten ergeben sich so neue Perspektiven. Ferner
zeigt sich am Beispiel der Online-Praxis DrEd, dass die Anony-
mität des Internets auch dazu beitragen kann, Patienten frü-
her zu erreichen, die sonst aufgrund von Hemmungen, etwa
bei Vorliegen einer Geschlechtskrankheit, einen Arztbesuch
so lange wie möglich hinauszögern würden.
Wie eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung
mit über 1.150 Teilnehmern von Ende 2015 zeigt, haben rund
Nutzungsbereitschaft in der Bevölkerung von
Video-Sprechstunden beim Haus- oder Facharzt
Quelle:
Bertelsmann Stiftung,
http://bit.ly/22opKmY. Grafik: REBMANN RESEARCH
29%
Eher selten
11%
Des Öfteren
4%
So häufig
wie möglich
37%
(Fast) gar nicht
19%
Noch unschlüssig
















